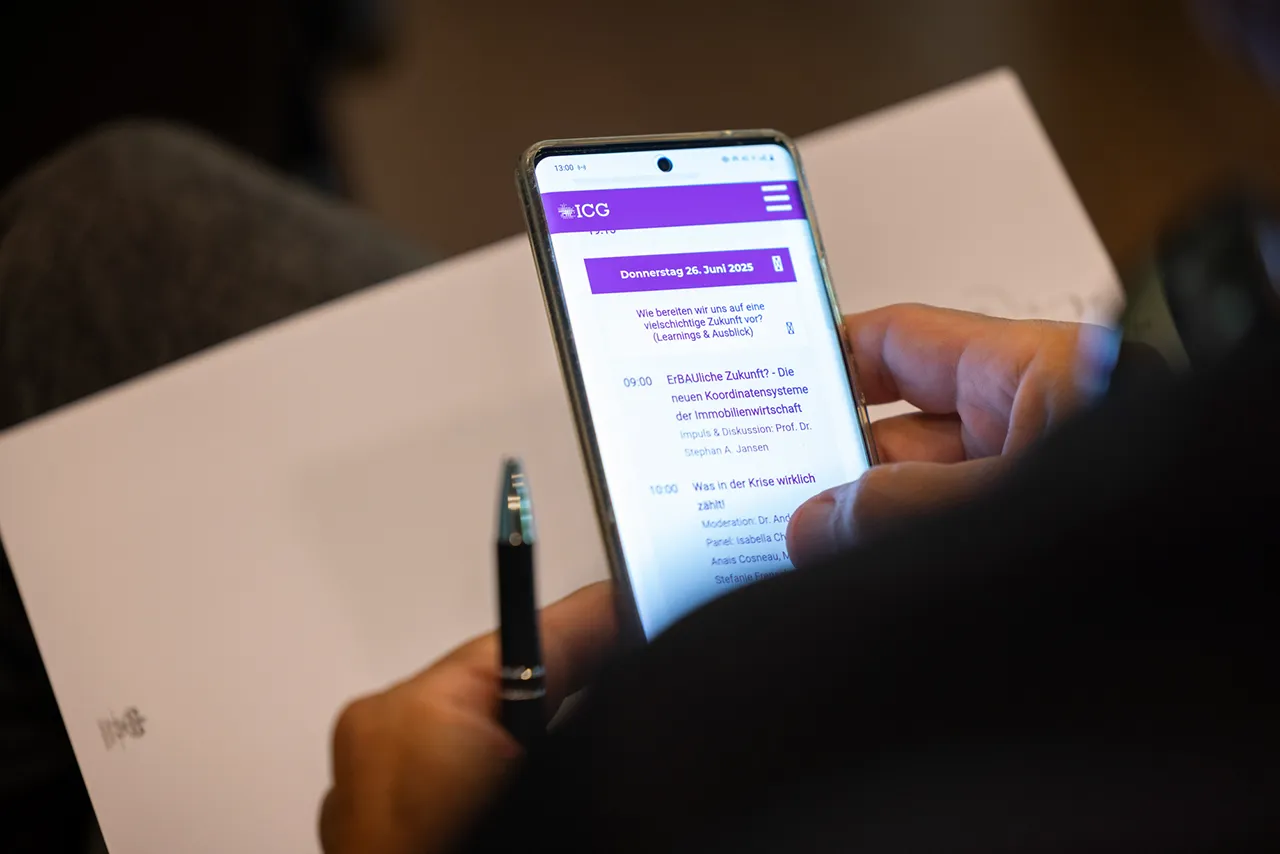16. German Real Estate Summit
Rückblick 2025
SUSTAINABLE GOVERNANCE
„Noch immer in der Krise :
Wie kommen wir wieder auf die Spur?“
Analyse, Learnings & Ausblick“
Europa – Quo Vadis?
Einführungsvortrag:
Susanne Eickermann-Riepe
Weiterlesen
1. Europa zwischen den Stühlen
Europa befindet sich in einer geopolitischen Sandwichposition zwischen den USA und China. Während die USA sich zunehmend abgrenzen, bietet China nicht nur Risiken, sondern auch Chancen zur Partnerschaft. „Wir sollten uns durchaus auch mit China beschäftigen, weil China auch in manchen Dingen ein Partner sein könnte.“ Gleichzeitig steht Europa wirtschaftlich auf Platz zwei weltweit, ein Potenzial, das nicht unterschätzt werden sollte.
2. Wirtschaftliche Schwächen und politische Unsicherheit
Mit rückläufiger Industrieproduktion, geringer Produktivität und wachsender Regulierung verliert Europa an wirtschaftlicher Dynamik. Die EU sei „in Formalismus und Regeln eingehüllt“, so Eickermann-Riepe. Ein System, das zwar nach außen gut vermarktbar sei, aber zunehmend brüchig wirke. Die aktuelle Lage sei ein „kritischer Pfad, was Governance und Sustainability angeht.“
3. Nachhaltigkeit als strategische Notwendigkeit
Trotz wachsender ESG-Skepsis betonte Eickermann-Riepe, dass Nachhaltigkeit kein moralischer Imperativ, sondern eine materielle Notwendigkeit sei: „Am Ende ist es materiell, wenn wir uns nicht um Nachhaltigkeit kümmern.“ Die EU habe das Potenzial, Innovationsführer zu werden, vorausgesetzt, Konsumentenperspektiven werden konsequent einbezogen.
4. Kosten, Komplexität und Konsequenzen
Digitalisierung, KI, Nachhaltigkeit und Verteidigung: All diese Themen werden teuer. Politische Subventionen seien keine langfristige Lösung. Europa müsse lernen, mit Widersprüchen zu leben und langfristig zu denken. „Wir müssen uns davon verabschieden, dass die Politik die Preise subventioniert, das wird nicht immer möglich sein“
Fazit:
Europa steht vor enormen Herausforderungen. Doch mit Kreativität, Mut zur Veränderung und einem klaren Fokus auf die Bedürfnisse der Menschen kann die EU nicht nur bestehen, sondern eine gestaltende Rolle in der Welt einnehmen.
„Das macht uns nicht zum Top-Akteur, aber vielleicht zum Top-Investmentstandort.“
Geopolitik trifft Wirtschaft
Impulsvorträge & Interview
Wirtschaft: Dr. Jürgen Michels
Geopolitik: Prof. Peter R. Neumann
Moderation: Susanne Eickermann-Riepe und Steffen Szeidl
Weiterlesen
1. „Die tektonischen Platten der Weltordnung verschieben sich – weg vom Westen.“
Neumann zeichnete ein klares Bild: Die Dominanz des Westens ist vorbei. China, Russland, Iran und andere revisionistische Staaten fordern die bestehende Ordnung heraus. „Wir sind in einem Interregnum, einer Übergangsphase voller Konflikte, bis sich eine neue Weltordnung etabliert.“ Europa müsse sich neu positionieren, neue Allianzen schmieden und wirtschaftliche Stärke zurückgewinnen.
2. „Geopolitik ist heute ein wirtschaftlicher Faktor erster Ordnung.“
Dr. Michels zeigte, wie politische Unsicherheit Kapitalmärkte beeinflusst – und wie schwer sie zu bepreisen ist. „Effiziente Märkte können geopolitische Risiken nicht einfach abfedern.“ Zölle, Lieferketten, Migration und Verteidigungsausgaben wirken direkt auf Inflation, Wachstum und Investitionsentscheidungen. Europa habe Chancen, müsse aber Reformen umsetzen und privates Kapital aktivieren.
3. „Wir brauchen strategische Souveränität und den Mut zur Selbstbehauptung.“
In der anschließenden Diskussion mit Susanne Eickermann-Riepe und Steffen Szeidl wurde deutlich: Europa muss sich emanzipieren – sicherheitspolitisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich. Neumann forderte: „Wir müssen nicht nur neue Partner suchen, sondern wir müssen auch selbst wieder ein Player werden.“ Michels ergänzte: „Die Werte Europas sind stark, aber wir müssen sie aktiv vertreten und gemeinsam handeln.“
4. „Geopolitik ohne Machtpolitik ist ein stumpfes Schwert.“
Hans Volkens warnte aus dem Publikum vor der innenpolitischen Krise Europas: „Wir erleben die Spaltung der Gesellschaften und brauchen ihre Einheit, um Demokratie und Wohlstand zu sichern.“ Die Panelisten waren sich einig: Die Zeit der reaktiven Krisenbewältigung ist vorbei. Jetzt braucht es strategische Klarheit, geopolitische Kompetenz und den Willen zur Gestaltung.
Fazit:
Geopolitik trifft Wirtschaft und verändert alles. Wer bestehen will, muss verstehen, gestalten und Verantwortung übernehmen. Europa muss raus aus dem Krisenmodus und rein in die Zukunft.
Immobilienwirtschaft in der Krise
Moderation: Dr. Johannes Conradi
Panel: Teresa Dreo-Tempsch, David Dreyfus, Henning Koch
Weiterlesen
1. „Wir dürfen nicht nur über die Situation sprechen, sondern wir müssen operativer werden in dem, wie wir unsere Strategien erreichen.“
Conradi forderte, die Diskussion über die Krise nicht bei der Analyse zu belassen. Es brauche konkrete Prozesse, neue Kompetenzen und den Mut, alte Routinen zu hinterfragen. Die Branche müsse sich fragen, wie sie ihre Strategien tatsächlich umsetzt und nicht nur darüber spricht.
Teresa Dreo-Tempsch griff diesen Gedanken auf und betonte die Notwendigkeit, die Realität anzuerkennen: „Wir träumen noch immer vom Zinsniveau, das zurückkommt, aber wir müssen akzeptieren, dass die Finanzierung teurer bleibt und die Renditeanforderungen steigen.“ Nur durch realistische Bewertungen und Abschreibungen könne wieder Dynamik entstehen.
2. „Wir müssen die Zukunft vorwegnehmen und nicht nur hinterherlaufen.“
Die Panelisten waren sich einig: Zukunftsorientierung muss Teil jeder Investitionsentscheidung sein. Hans Volkens ergänzte aus dem Publikum: „Wenn ich nicht ausreichend Zukunftsfragen in meinem Ankauf beurteile, dann verstoße ich gegen fundamentale Prinzipien der Sorgfalt.“ Die Immobilienwirtschaft müsse sich von der Gegenwartsfixierung lösen und Szenarien aktiv durchdenken.
3. „Die Immobilienwirtschaft soll sich nicht nur an die Realität anpassen, sondern sie aktiv mitgestalten.“
Das Schlussfazit von Dr. Johannes Conradi brachte die Diskussion auf den Punkt: Die Branche darf nicht nur reagieren, sie muss gestalten.
Henning Koch kritisierte die zyklische Kurzsichtigkeit der Branche und forderte mehr Fokus auf die „Fundamentals of Real Estate“ statt auf zinsgetriebene Finanzströme. Andererseits plädierte David Dreyfus für einen Innovationsschub aus der Industrie selbst: „Wir brauchen neue Visionen und den Mut, sie umzusetzen.“ Er verwies auf modulare Bauweisen, KI-gestützte Planung und die Notwendigkeit, Prozesse neu zu denken, um Projekte wieder wirtschaftlich zu machen.
Fazit:
Die Immobilienwirtschaft steht nicht nur vor einer Krise, sie steht an einem Wendepunkt. Wer Zukunft denkt, Prozesse verändert und den Nutzer in den Mittelpunkt stellt, kann aus der Krise eine neue Stärke entwickeln.
Jetzt ist die Zeit, nicht nur zu reagieren, sondern zu gestalten!
Herausforderungen und Problemstellungen
Workshops zu den „4 D’s“ (Demokratie, Digitalisierung, Deglobalisierung, Dekarbonisierung)
Moderation: Stefanie Frensch, Philipp Luckas, Prof. Verena Rock, Prof. Elisabeth Schütze, Romy Schwenkert
Weiterlesen
1. Dekarbonisierung: Der Druck steigt und mit ihm die Verantwortung
Gebäude lassen sich nicht verlagern und genau das macht die Dekarbonisierung so herausfordernd. „Da, wo die Gebäude sind, müssen wir mit dem spielen, was da ist“, hieß es im Workshop. Doch die kommunale Wärmeplanung kommt nicht hinterher: „60 % der Stadtwerke sagen: Wir werden das nicht schaffen.“ Auch wirtschaftlich stoßen viele an Grenzen: „Wir investieren, aber es gibt keine Mietenden, die die bezahlen wollen.“ Die Teilnehmer:innen waren sich einig: Ohne Transparenz, Nutzeraufklärung und neue Finanzierungsmodelle wird die Klimawende nicht gelingen.
2. Digitalisierung:
Der Workshop zur Digitalisierung zeigte: Die Branche steht noch am Anfang. Die Herausforderungen sind groß. Die zentrale Erkenntnis: „Der Erfolg von digitalen Transformationsprojekten hängt im Wesentlichen ab von einer konstruktiven Fehlerkultur, von Experimentierfreudigkeit und vor allem vom Thema Lernen und Weiterbildung.“
3. Demokratie:
Was bedeutet Haltung im Unternehmenskontext? Für die Teilnehmenden war klar: „Erstmal diese Thematik mit sich selber auszumachen und zu verstehen, wie schwer es ist, diese Haltung zu haben.“ Haltung braucht Mut, Ausdauer und Selbstreflexion. Besonders eindrücklich war die Idee der Wertebotschafter. Haltung ist also kein Aushängeschild, sondern sie ist gelebte Verantwortung.
4. Deglobalisierung: „Make Europe Great Again?“
Mit einem Augenzwinkern, aber ernstem Kern diskutierte die Gruppe die Chancen einer neuen europäischen Selbstverortung. „Wir müssen mehr in Europa denken“, lautete ein zentrales Fazit. Die Diskussion reichte von Rohstoffabhängigkeit über Forschung bis hin zur Frage: „Wollen wir, dass ausländisches Geld in kritische Infrastruktur investiert wird?“ Die Lösung? „Wir sollten viel mehr in den Dialog gehen, uns gegenseitig austauschen, weil der Druck, dass wir es ändern, ist extrem hoch.“
Fazit:
Die Workshops waren keine bloßen Denkübungen, sie waren ein Weckruf. Was bleibt, ist der Mut zur Verantwortung, der Wille zur Zusammenarbeit und die Erkenntnis: Transformation beginnt mit Haltung.
Kopf hoch – Wie wir Mut und Zuversicht entwickeln in herausfordernden Zeiten
Key Note: Prof. Dr. Volker Busch
Weiterlesen
1. Die Macht der Gedanken und Information
Busch betonte, dass unsere Wahrnehmung der Welt stark durch negative Medieninhalte geprägt ist. Studien belegen, dass die Sprache in deutschen Medien besonders pessimistisch ist. Der Mensch verarbeitet täglich 30-40 GB an Informationen, mehr als ein Bauer des 18. Jahrhunderts im gesamten Leben. Diese Reizüberflutung führt zu innerer Unruhe und mentaler Erschöpfung.
2. Warum wir die Zukunft falsch einschätzen
Der Mensch ist biologisch darauf ausgelegt, Zukunft vorherzusehen. Doch unsere Zukunftsprognosen sind häufig emotional verzerrt und dadurch meist negativer als die Realität. Statistisch gesehen verlaufen über 70 % der Krisen besser als erwartet, weil der Mensch aktiv wird und Lösungen entwickelt (die „gestaltete Zukunft“).
3. Mut durch Möglichkeit: der Possibilismus
Statt in Pessimismus oder naivem Optimismus zu verharren, plädiert Busch für eine dritte Haltung: den Possibilismus. Dieser bedeutet, realistisch und lösungsorientiert zu handeln. Gerade in Zeiten mittlerer Unsicherheit ist das menschliche Gehirn besonders leistungsfähig. Dieses Prinzip veranschaulichte er mit der Fabel von drei Fröschen in einem Sahneeimer: Nur der strampelnde „Possibilist“ überlebt, weil er Butter erzeugt und sich rettet.
4. Mentale Stärke durch Reduktion des Negativen
Ein zentrales Konzept des Vortrags ist das Glück durch das Weglassen des Unglücks. Es geht darum, den mentalen Ballast zu reduzieren: übermäßiger Medienkonsum, destruktive Gespräche oder ständige Erreichbarkeit führen zu einer Reizüberflutung und überlasten unser emotionales Alarmsystem (die Amygdala). Durch bewusstes Filtern von Information könne der mentale Garten „gejätet“ werden, damit Zuversicht, Kreativität und Leichtigkeit wieder wachsen können.
5. „Kopf hoch“: die Blickrichtung für ein gelingendes Leben
Der Titel „Kopf hoch“ ist mehr als eine Floskel. Nur wer aufblickt kann Chancen erkennen und aktiv werden. Busch greift hier die griechische Kairos-Geschichte auf: Der Gott des günstigen Augenblicks fliegt über die Menschen hinweg und kann nur ergriffen werden, wenn man nach oben schaut. Wer den Kopf senkt, verpasst die Gelegenheiten.
„Kopf hoch“ heißt deshalb nicht: alles wird gut. Sondern: Sei offen für das, was möglich ist. Bleib aufmerksam. Warte nicht auf Gewissheit, sondern handle!
ErBAUliche Zukunft? – Die neuen Koordinatensysteme der Immobilienwirtschaft
Impulsvortrag: Prof. Dr. Stephan A. Jansen
Prof. Dr. Stephan A. Jansen ist ein Denker mit Tempo und mit Haltung. In seinem Vortrag nahm er das Publikum mit auf eine rasante Reise durch Krisen, Chancen und konkrete Zukunftsbilder. Sein Ziel: größer denken und gemeinsam gestalten.
Weiterlesen
1. „Ihr müsst größer denken. Und das bedeutet: über euch hinaus.“
Jansen beginnt mit einem klaren Appell: Die alten Koordinatensysteme, also Neubau vs. Bestand, Immobilie vs. Quartier, analog vs. Digital, greifen nicht mehr. Doch statt Resignation fordert er Aufbruch: „Das Überraschende ist euer Job. Arsch hoch! Das ist euer Job.“
Er zeigt, wie Städte wieder zu Orten der Gesundheit, Teilhabe und Lebensqualität werden können. „Gesunde Städte, das gönnen wir sogar unseren Feinden, damit sie uns nicht anstecken.“ Dabei geht es nicht um Ideologie, sondern um Wirkung: „Wenn man eine Stadt so entwickelt, dass Frauen sich darin wohlfühlen, steigen die Immobilienwerte.“
2. „Die Stadt muss wieder für Kinder, Betagte und alle da sein.“
Mit dem Konzept der „100cm-Stadt“ macht Jansen sichtbar, wie sehr unsere Städte auf Erwachsene, und vor allem auf Autos, ausgerichtet sind. Er fordert eine neue Perspektive: „Ein Kind kann sich in vielen Städten überhaupt nicht mehr zurechtfinden.“ Gleichzeitig zeigt er, dass es anders geht mit Beispielen aus Wien, Paris und Helsinki, wo urbane Innovationen bereits Realität sind.
3. „Digitalisierung ist kein Tool, sie ist ein urbaner Raum.“
Jansen warnt vor digitaler Trägheit, aber sieht auch enormes Potenzial: „Die Städte sind jetzt die Treiber der Digitalisierung und sie brauchen euch.“ Digitale Zwillinge, urbane Datenräume über KI-gestützte Planung bis Industrielles Metaverse eröffnen neue Möglichkeiten für nachhaltige, resiliente Quartiere. „Wir können bauen. Die Big Techs können das nicht.“
4. „Das nächste Paradigma ist nicht ESG, es ist Gesundheit.“
Am Ende steht eine klare Vision: Städte, die nicht nur funktionieren, sondern guttun. „Beteiligt zu sein ist gut für die Gesundheit.“ Jansen ruft auf zu intersektoralen Allianzen, zu Co-Design mit Bürger/-innen, zu mutigen Prototypen. „Wir brauchen Pro für das Testen statt Protest, wir müssen Prototypen bauen.“
Fazit:
Prof. Stephan A. Jansen hat nicht nur analysiert, sondern inspiriert. Sein Vortrag war ein leidenschaftliches Plädoyer für eine Immobilienwirtschaft, die Verantwortung übernimmt und Zukunft gestaltet. Denn wie beim Radeln: die zweite Luft kommt und wer jetzt Kurs hält, wird vorne ankommen.
Was in der Krise wirklich zählt!
Moderation: Dr. Andreas Iding
Panel: Isabella Chacón Troidl, Anais Cosneau, Michael Ehret, Stefanie Frensch, Steffen Szeidl
Weiterlesen
1. „Unternehmen scheitern ja nicht an der Krise, sondern daran, dass sie keine Antwort auf eine Krise haben.“
Für Isabella Chacón Troidl war klar: Resilienz beginnt mit Struktur. „Diversifikation sowohl hinsichtlich der Geographie als auch hinsichtlich der Asset-Klassen hat uns natürlich geholfen.“ Die Krise habe zudem einen Digitalisierungsschub ausgelöst: „Wir haben einen deutlichen technologischen Vorschub in unseren Beständen vornehmen können, der durch die Krise beschleunigt wurde.“
2. „Transparenz ist sehr hilfreich – und Kommunikation schafft Aufbruchskultur.“
Stefanie Frensch betonte die Bedeutung langfristiger Perspektiven: „Langfristig orientierte Unternehmen haben die Chance, eine Krise gut zu überstehen.“ Besonders wichtig sei es gewesen, „Klarheit und Wahrheit an die Kollegen“ zu kommunizieren und so Verständnis für neue Prozesse zu schaffen.
3. „Wir müssen vom Developer zum Operator werden.“
Michael Ehret forderte ein Umdenken in der Projektentwicklung: „Wir geben kopfmäßig den Schlüssel ab, wenn es fertig gebaut ist.“ Stattdessen brauche es langfristige Verantwortung: „Wir müssen den gesamten Lebenszyklus unserer Immobilien betrachten und wissen wie sich auch die Nutzerbedürfnisse im Zeitverlauf verändern. Dabei kann beispielsweise ein Quartiersmanagement helfen. Und zwar eines, das nicht nur reagiert, sondern das soziale und kulturelle Zusammenleben im Quartier von Beginn an bewusst kuratiert und dabei den Dialog mit allen Beteiligten im Quartier proaktiv pflegt.“
4. „Wir haben viel zu wenig mit den Bürgern gesprochen.“
Anais Cosneau plädierte für mehr Dialog mit der Gesellschaft: „Jeder muss eigentlich wissen, wie kauft man eine Wohnung, wie funktioniert die Immobilienwirtschaft.“ Sie berichtete von einem erfolgreichen Projekt: „Aus einem Wohnungsstammtisch ist ein wahnsinnig tolles Quartier entstanden, radikal durchmischt, und es funktioniert.“
5. „Das Überraschende oder Unvorhersehbare und damit umzugehen ist unser Job.“
Steffen Szeidl betonte die Notwendigkeit von Agilität und Weitblick: „In dem Moment, wo du dich anfängst auszuruhen, ist das der Beginn der Abwärtsspirale, des Abstiegs.“ Auch in der Krise gelte: „Was muss ich heute auslösen, damit wir in vier oder fünf Jahren dieses Thema realisieren können und weiterhin zukunft- und wettbewerbsfähig sind?“
Fazit:
Das Panel zeigte eindrucksvoll: Krisen sind kein Ausnahmezustand, sie sind Teil der Realität. Doch wer kommuniziert, diversifiziert und langfristig denkt, kann nicht nur bestehen, sondern gestalten.
Wert und Werte: Was lohnt sich?
Workshop-Moderation: Brigitte Adam, Prof. Dr. Thomas Beyerle, Philipp Luckas & Romy Schwenkert
Weiterlesen
1. „Werte werden sich verändern – aber besser durch uns als gegen uns.“
Die erste Gruppe stellte klar: Werte wie Vertrauen, gesunder Menschenverstand und persönliche Integrität sind nicht verhandelbar. „Der Fisch stinkt von oben“, hieß es mehrfach – Führung muss glaubwürdig vorangehen. Gleichzeitig wurde betont: „Solange man die Werte selbst verändern kann, über den demokratischen Prozess, sind sie immer noch besser, als wenn man reaktiv handelt.“
2. „Sind Wert und Werte vereinbar?“ – „Nein“, sagte eine Teilnehmerin.
Die zweite Gruppe stellte diese unbequeme Frage gleich zu Beginn. In angespannten Märkten, etwa im Wohnungsbau, sei es schwer, ethischen Ansprüchen gerecht zu werden. Dennoch: „Es gibt gewisse Mindestanforderungen, die mittlerweile jedes Projekt erfüllen muss.“ Besonders betont wurde: „Wir müssen es schaffen, dass wir viel, viel mehr Transparenz in den Markt reinbekommen.“ Vorschläge reichten von Blacklists für unethisches Verhalten bis hin zu mehr öffentlicher Kommunikation: „Wir sind nicht nur die Immobilienhaie, die das Geld abcashen wollen.“
3. „Es muss sich ja doch rechnen.“
Die dritte Gruppe näherte sich dem Thema mit einem Augenzwinkern – und einer klaren Botschaft: „Wissen ist nicht nur Macht, sondern Wissen ist Gewinn.“ Best Practices wie kuratierte Erdgeschosszonen, Belegungsrechte oder gemischte Quartiere mit sozialem Mehrwert zeigten: Werteorientierung kann wirtschaftlich erfolgreich sein. Oder wie es ein Teilnehmer formulierte: „Alles über null hat sich gerechnet.“
Fazit:
Die Workshops zeigten eindrucksvoll: Werte und Wirtschaftlichkeit schließen sich nicht aus, sie brauchen einander. Es braucht aber Bereitschaft zum Dialog und die Fähigkeit, neu zu denken, denn „Wenn man miteinander redet, kann man auch produktiv Deals machen.“
Neue Formen des Wirtschaftens
Vortrag: Wiebke Merbeth
Weiterlesen
1. „Wir müssen aufhören, Nachhaltigkeit in seiner Komplexität herauszufordern und anfangen, über Transformation zu sprechen.“
Merbeth plädierte für einen sprachlichen und strategischen Wandel: „Das Wort Nachhaltigkeit hatte seine Zeit.“ Stattdessen brauche es neue Narrative wie „GreenTech“, „CleanTech“ oder „Transitionsfinanzierung“. Denn: „Wirtschaftlicher Erfolg ohne soziale und kulturelle Stabilität wird zunehmend fragil.“
2. „Nicht die Stärksten überleben, sondern die Anpassungsfähigsten.“
Sie forderte ein Umdenken in der Risikobewertung: „Wenn Klimarisiken uns langfristig Geld kosten, dann kann ich nicht nachvollziehen, warum es bei so vielen noch Nicht-finanzielle Berichterstattung genannt wird.“ Klimarisiken sei kein Add-on, sondern „finanziell relevant“.
3. „Sind eure Geschäftsmodelle 3°-kompatibel?“
Mit Blick auf die Realität des Klimawandels stellte Merbeth unbequeme Fragen: „Sind eure Prozesse, eure Lieferketten, eure Produkte in der Lage, mehrere Tage über 30° auszuhalten und den Extremwetterereignissen zu strotzen?“ Sie forderte: „Nur noch in Mindestkritierien denken und rote Linien formulieren: Was muss wirklich berücksichtigt werden? Welche wenigen KPIs? Welche Stakeholder konkret?“
4. „Demokratie basiert nicht auf Wahrheiten, sondern auf Mehrheiten.“
Merbeth sprach offen über politische Blockaden, regulatorische Rückschritte und die Rolle der Verbände: „Dieses Jahr ist das Jahr der Verbände, für Statements, für Handreichungen, für Checklisten.“ Gleichzeitig warnte sie vor Überforderung: „Vielleicht reicht es, einfach mal zu sagen: Wir fangen damit an, rote Linien zu definieren.“
Fazit:
Wiebke Merbeths Vortrag war ein Weckruf analytisch, provokant, aber auch konstruktiv. Sie zeigte: Neue Formen des Wirtschaftens entstehen nicht durch Perfektion, sondern durch Pragmatismus, Mut und Systemdenken. Oder wie sie es selbst sagte: „Transformation ist kein Zustand, sondern ein Weg.“
Die Welt ist laut geworden – neue Formen für den Dialog?
Impulsvorträge & open space-Plenumsdiskussion
Thomas Beyerle und Waltraud Gläser
Moderation: Werner Knips und Karin Barthelmes-Wehr
Weiterlesen
1. „Man kann heute nichts mehr einfassen. Es ist eine Mikrosekunde drin. Punkt!“
Beyerle analysierte die neue Realität der externen Kommunikation: „Wir sind sozialisiert worden durch rationale Kommunikation, aber das reicht nicht mehr.“ In einer Welt der Echtzeitreaktionen brauche es Mut zur Klarheit und strategische Flexibilität. Kommunikation müsse schneller, direkter und authentischer werden, ohne in Beliebigkeit zu verfallen: „Wenn man Kommunikation macht, dann muss man es ernst nehmen und durchhalten.“
Er plädierte für eine neue Tonalität: „Agieren, nicht gegen die Wirklichkeit in Schönheit sterben.“ Unternehmen müssten lernen, mit Ambivalenz umzugehen und sich nicht in PR-Floskeln zu verlieren.
2. „Warum sind wir eigentlich dumm genug, nicht die kollektive Intelligenz zu nutzen?“
Waltraud Gläser forderte einen Paradigmenwechsel in der internen Kommunikation, also weg vom Alpha-Top-down, hin zu Beta-Strukturen mit Vertrauen, Beteiligung und Sinnorientierung. „Führen durch Vorbild wird nicht unmodern“, betonte sie. Kommunikation beginne mit echtem Interesse: „Ich habe Interesse, mit einem Menschen zu kommunizieren, auch wenn mein Posteingang überquillt.“
Sie rief dazu auf, Mitarbeitende als Menschen vom Typ Y zu sehen: „Wir sind mehr als nur Jobholder.“ Und: „Was ist das Thema hinter dem Thema? Welche Bedürfnisse stehen dahinter?“
3. „Ich bin ich, du bist du – was heißt das für unser Wir?“
In der Diskussion wurde deutlich: Unternehmen müssen Haltung zeigen, aber mit Augenmaß. Die Frage, ob man sich als Unternehmen politisch positionieren sollte, wurde kontrovers diskutiert. Gläser plädierte für Klarheit: „Ich möchte schon wissen, wo ich dran bin.“ Gleichzeitig brauche es Raum für Differenzierung und Dialog und die Bereitschaft, auch Spannungen auszuhalten.
Fazit:
Die Welt ist laut geworden, aber Dialog ist möglich. Wer zuhört, wer Klarheit mit Empathie verbindet, wer Haltung zeigt, ohne zu spalten, kann Orientierung geben. Oder wie Gläser es formulierte: „Lasst uns gemeinsam schreiben, was die zukünftige Geschichte unseres Unternehmens sein soll.“
Der Blick nach vorne
Impuls: Susanne Eickermann-Riepe
Weiterlesen
1. „Haben wir ausreichend Mut und Zuversicht?“
Eickermann-Riepe erinnerte an zentrale Begriffe der vergangenen Tage: „Siebe und Systeme, Schilfrohr, Dopamin und Vögel“. Sie rief dazu auf, sich auch in schwierigen Zeiten an das zu erinnern, was trägt und was inspiriert: „Vielleicht schaut ihr jeden Tag einmal, ob ihr irgendwo eine Locke findet, die ihr greifen könnt.“
2. „Der Westen wird kleiner, aber wir können weiterhin mitspielen.“
Mit Blick auf geopolitische Verschiebungen mahnte sie zur Wachsamkeit: „Wir müssen schon darauf schauen, was in der Welt ansonsten passiert.“ Europa dürfe nicht zum Museum werden, sondern müsse sich anpassen, ohne sich selbst zu verlieren.
3. „Werdet zu Possibilisten.“
Ein zentrales Motiv ihrer Rede war der Begriff des Possibilismus: „Man muss die Möglichkeiten identifizieren, die man überhaupt hat.“ Sie rief dazu auf, Chancen zu erkennen, flexibel zu bleiben und dennoch Haltung zu zeigen: „Ein paar Eigenschaften des flexiblen Schilfrohrs können helfen, aber man sollte das langfristige Ziel nicht aus den Augen verlieren.“
4. „Immobilien sind Lebensträume, keine bloßen Finanzprodukte.“
Besonders eindrücklich war ihr Plädoyer für die emotionale Dimension der Branche: „Immobilien sind emotional. Deshalb macht mir das Spaß.“
Sie erinnerte an ein Interview, in dem sie gefragt wurde, was Immobilien für sie bedeuten: „Es sind Objekte, die für Menschen zum Leben und Arbeiten und für alle mögliche Aktivitäten gebaut werden.“ Und sie ergänzte: „Genau diese Emotion solltet ihr alle mitnehmen bei allem, was ihr tut.
Immobilien seien Teil von Lebensgeschichten und genau darin liege ihre gesellschaftliche Relevanz. „Wissen, Emotion und Verantwortung gehen Hand in Hand.“
Fazit:
Mit einem Augenzwinkern, aber auch mit Ernsthaftigkeit rief Susanne Eickermann-Riepe dazu auf, mit Stolz, Klarheit und Offenheit in die Zukunft zu gehen. „Werdet zu Possibilisten und entdeckt die Möglichkeiten.“